Ein Professor räumt auf
Berner Therapieskandal / 27. Juli 1996, "Das Magazin"
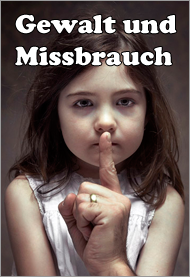
Der Fall des umstrittenen Sexualtherapeuten Andreas Blaser wirft ein Licht auf den Berner Filz - und Anti-Filz.
Seit langem kleben Bern und der Filz zusammen wie Pech und Schwefel. Ob beim Finanzskandal (1984), dem Debakel der Kantonalbank (1992), der Justizaffäre um den Fall Zwahlen (93/94) oder bei der Mordsache Marcel Walther (1995): Immer war auch die Rede von Vetternwirtschaft und Filz. Doch jetzt hat Bern auch eine Anti-Filz-Affäre: Allmählich kommt Licht in den Fall um den hochangesehenen Psychologieprofessor Andreas Blaser, dem ehemalige Patientinnen sexuelle Übergriffe zum Vorwurf machen. - Nicht weil die Behörden reagierten, sondern weil der Vorgesetzte des Professors unerschrocken handelte.
Professor Hans-Ulrich Fisch schätzt klare Verhältnisse über alles. Also missfiel es dem Direktor der Psychiatrischen Universitätspoliklinik in Bern, als sich Behörden und Berufsverbände anschickten, einen gravierenden Fall unter den Teppich zu kehren, der auch ihn betrifft: Im Zentrum der Ereignisse steht einer seiner Angestellten, der bekannte Psychologie-Professor und Sexualtherapeut Andreas Blaser. Fisch konnte nicht akzeptieren, dass die Akte Blaser nach einer oberflächlichen Untersuchung geschlossen werden sollte. Nach längerem Zuwarten handelte er deshalb auf eigene Faust. Er tat es - wie sich allmählich zeigt - mit beachtlichem Erfolg.
Verdacht auf sexuelle Übergriffe
Gegen Professor Blaser, ein angesehenes Mitglied der Berner Gesellschaft mit weitverzweigtem beruflichem Tätigkeitsfeld, besteht der Verdacht, dass er seine therapeutische Macht missbraucht und wiederholt sexuelle Grenzverletzungen gegenüber Patientinnen begangen hat. Ebenso offensichtlich ist, dass der Berner Filz den Professor zu schützen versucht. "Diese unheimliche Geschichte", sagt Professor Fisch, "verlangt nach einer sauberen Aufarbeitung."
Für Fisch ist sexueller Missbrauch in Psychotherapien "eine der extremsten Grenzverletzungen, für die allein der Therapeut die Verantwortung trägt." Was vielfach harmlos beginne, ende oftmals mit schweren Schädigungen der Opfer, die aus Scham dennoch darauf verzichteten, eine Klage einzureichen.
Letzten Herbst, als sich sein leitender Psychologe Blaseröffentlich als Querdenker zum Thema Sex in Therapien profilierte, begann sich Fisch mit dem Fall zu beschäftigen. Erschüttert nahm Fisch Blasers Ansichten zur Kenntnis, wonach "sexuelle Handlungen in Therapien auch einen positiven Ausgang haben können", und der sexuelle Übergriff erst "bei genitalen Handlungen" beginne. Blaser gestand freimütig ein, Patientinnen "auch an den Innenseiten der Oberschenkel" zu berühren und sie auf Wunsch nackt zu behandeln.
In Fachkreisen wurden Blasers Statements teils mit Verwunderung, mehrheitlich aber mit Empörung aufgenommen. Experten wie der Zürcher Psychoanalytikerin Ursula Wirtz war seit langem bekannt, dass die "verharmlosenden Einschätzungen sexueller Interaktionen zwischen Therapeut und Patientin häufig auf Kollegen zurückgehen, die selbst in sexuelle Beziehungen mit ihren Patientinnen verstrickt sind." Ein schlagendes Beispiel für die Richtigkeit dieser These war Monate zuvor aus Zürich gekommen: Der Therapeut Emil Pinter hatte seine sexuellen Übergriffe an Patientinnen in einem Buch als heilungsfördernd angepriesen, was eine Strafuntersuchung nach sich gezogen hatte.
Kommission sah keinen Handlungsbedarf
Solche Konsequenzen blieben im Fall Blaser zunächst aus. Die einzige Reaktion bestand darin, dass ein Mitglied der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) den Vorstand der Organisation um eine Stellungnahme ersuchte - unter Hinweis auf die Berufsordnung, welche verlangt, dass "FSP-Mitglieder alle Verhaltensweisen sexueller Art gegenüber Klientinnen und Klienten unterlassen." Der FSP gehört auch Blaser an.
Der Vorstand übergab die kritische Anfrage der Berufsordnungskommission BOK, die für die Behandlung von Beschwerden zuständig ist, und der mindestens fünf, maximal sieben Personen angehören. Die Bearbeitung übernahm Peter Landolf, Psychotherapeut in Bern. Er sah keinen Handlungsbedarf. Bei Landolf handelt es sich um einen langjährigen engen Kollegen und Weggenossen Blasers. Obwohl die Mitglieder der BOK Befangenheitsregeln kennen, sah Landolf keinerlei Anlass, in den Ausstand zu treten. Seither hat sich die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen zum Fall Blaser nie mehr geäussert.
Eine ähnliche Erfahrung hatte der Berner Lokaljournalist Matthias Mast Anfang der neunziger Jahre gemacht. Mast war Gerüchten nachgegangen, wonach Blaser Patientinnen sexuell missbrauche. Im Verlaufe seiner Recherchen bat er den zuständigen Berner Regierungsrat Hermann Fehr, Vorsteher der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion, um einige Auskünfte. Zum Fall Blaser erfuhr Mast wenig Sachdienliches. Doch eine halbe Stunde später erhielt der Journalist einen Anruf von Blaser, den er zu jenem Zeitpunkt noch gar nicht kontaktiert hatte. Mast war "erstaunt über den direkten Draht zwischen den Behörden und Blaser". Regierungsrat Fehr kann sich heute "an nichts mehr erinnern".
Je länger sich Fisch mit dem Fall Blaser beschäftigte, desto grösser wurde sein Unbehagen. Tatsache war, dass es in Bern seit Jahren Gerüchte gab, wonach Blaser es zuweilen an der nötigen Abgrenzung gegenüber Patientinnen, aber auch gegenüber Mitarbeiterinnen hatte fehlen lassen. Entsprechende Vermutungen kursierten auch rings um Blasers sexualtherapeutische Tätigkeit am Frauenspital.
Disziplinarische Untersuchung
Als direkter Vorgesetzter von Blaser wollte Fisch endlich Klarheit. Am 20. November 1995 beantragte er bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion "eine disziplinarische Untersuchung gegen Herrn Professor Andreas Blaser zur Klärung seiner Tätigkeit am Frauenspital und den damit in Zusammenhang stehenden Gerüchten."
Am Berner Frauenspital leitet Blaser seit Jahren die Spezialsprechstunde für Psychosomatik und Sexualtherapie. Seine sexualtherapeutische Behandlung von Frauen, die unter Vaginismus leiden und wegen Krämpfen in der Vaginalmuskulatur einen Penis nicht oder nur unter grossen Schmerzen aufnehmen können, war schon seit langem umstritten. Während Jahren führte Blaser solchen Patientinnen eigenhändig Silikonstäbe in die Scheide ein, um sie, wie er sagt, "von ihrem Leiden zu befreien". Mit diesem Vorgehen setzte er sich indessen über die gängigen Praktiken von sexualtherapeutischen Instituten in Hamburg, Frankfurt, Genf und Zürich hinweg. Betroffene Frauen geisselten seine Behandlung als "eindeutige Gewalterfahrung."
Kaum war diese Debatte - auf der Basis eines Teils der hier vorliegenden Recherchen - öffentlich geworden, wurden auch in Bern vernichtende Urteile laut. Professor Rolf Adler, Psychosomatik-Experte und Chefarzt am Inselspital, nannte die von Blaser praktizierte Vaginismusbehandlung "einen unbegründbaren und unverzeihlichen Kunstfehler." Der Paartherapeut Klaus Heer sprach von "mechanischem Auswuchten der Frau." Immerhin mochte sich eine ehemalige Patientin aber auch öffentlich zugunsten des umstrittenen Professors äussern. "Dank seiner Hilfe", liess sie verschiedene Redaktionen wissen, "war es möglich für mich, einen Mann zu lieben, ihn zu heiraten und eine Familie zu gründen."
Einmal mehr griff auch Blasers hilfreicher Kollege Peter Landolf in die Tasten und eilte dem bedrängten "Andi" in einem Leserbrief zu Hilfe. Diesmal warf Landolf das ganze Gewicht seiner Funktion als Ombudsmann des Verbandes Bernischer Psychologinnen und Psychologen (VBP) in die Waagschale und erkannte seitens der Presse "Voreingenommenheit" und "Irreführung". Tatsache sei, schloss Landolf seinen Brief, "dass bisher keine einzige konkrete Beschwerde oder Klage gegen Blaser vorliegt." Das ist auch nicht weiter erstaunlich, wenn just der Ombudsmann selber, also der Adressat allfälliger Beschwerden, öffentlich Partei ergreift. Für Landolf bestand nach eigenen Aussagen "von der Berufsethik her kein Grund, Blaser einen Verweis anzuhängen", nur weil sich für diesen Sex und Therapie nicht ausschliessen.
Verständnis für Blaser
Nicht nur Landolf, sondern auch die mitverantwortliche Ombudsfrau des VBP, Ursula Sauter-Schär, signalisierte Verständnis für Blaser. Sauter-Schär hält es für möglich, dass der Professor "seine provokativen Aussagen nicht so ernst meint, wie er sie ausdrückt". Auch die Ombudsfrau kennt den "Andi" seit 25 Jahren. Schliesslich war Blaser selber jahrelang Mitglied der Beschwerdekommission des VBP. Immerhin hat der Bernische Verband, alarmiert von der öffentlichen Diskussion, kürzlich dafür gesorgt, dass der umstrittene Professor seinen Sessel in diesem Gremium räumte.
Ende letzten Jahres ergriff dann auch Fisch eine Massnahme, um seine Position klarzustellen: Er kündigte den Delegationsvertrag zwischen der Psychiatrischen Universitätspoliklinik und dem Frauenspital. Damit entband er sich von der direkten, von ihm als "untragbar" empfundenen Verantwortung für Blasers Sexualsprechstunde am Frauenspital. "In einem so delikaten Bereich wie der Sexualtherapie", erklärt Fisch seinen Entscheid, "verträgt es keine Fachperson, die dermassen in Verruf geraten ist."
Doch Henning Schneider, Direktor des Frauenspitals, liess sich vom Vorgehen Fischs nicht beeindrucken. Er hielt nicht nur an der Zusammenarbeit mit Blaser fest, sondern schwört nach wie vor auf die Kompetenz des Sexualtherapeuten. Mit Gerüchten bezüglich sexueller Übergriffe will er kein einziges Mal konfrontiert worden sein.
Allerdings sah sich Schneider durch eine Weisung von Regierungsrat Fehr dazu gezwungen, in seiner Klinik zumindest die von Blaser praktizierte Vaginismusbehandlung zu stoppen. Als der Methodenstreit auf seinem Höhepunkt angelangt war, hatte sich nämlich auch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion "von Amtes wegen" veranlasst gesehen, eine aufsichtsrechtliche Untersuchung einzuleiten. Diese Untersuchung, heisst es offiziell, habe sich jedoch "nicht gegen Professor Blaser gerichtet", sondern allein dazu gedient, "Ermittlungen zu dessen Aktivitäten am Frauenspital zu führen".
"Formeller Entscheid" der Regierung
Die "Ermittlungen" führten zu einem wenig überraschenden Ergebnis: Es habe sich, so Regierungsrat Fehr, kein Anlass für weitere Abklärungen oder gar für die Einleitung eines Verfahrens gegen Blaser ergeben. Seinen Stop der Vaginismustherapie will Fehr zudem ausdrücklich als "formellen, aber nicht materiellen Entscheid" verstanden wissen, "der sich im Zuge einer veränderten vertraglichen Situation ergeben" habe. Damit legte Fehr den Fall Blaser zu den Akten. Professor Fisch, der immerhin eine disziplinarische Untersuchung gegen seinen Untergebenen angestrengt hatte, wurde mit einem Pro Forma-Schreiben über den Abschluss der amtlichen Ermittlungen informiert.
Dass die Behörden keinen Handlungsbedarf erkannten, erstaunt um so mehr, als die Verantwortlichen im Besitz eines mehrseitigen Briefes einer ehemaligen Patientin von Blaser waren. In diesem Schreiben, adressiert an Regierungsrat Fehr, erhebt Frau N.* schwere Vorwürfe gegen Blaser: "Er lügt, wenn er sagt, dass er keiner Frau vorschreibe, nackt vor ihm zu erscheinen. Als ich mich weigerte, mich auszuziehen, bedeutete dies das Ende der Therapie. Es gab keine Alternative bei und für Herrn Blaser." Nachdem er ihr vorgängig erklärt habe, dass sie sich ausziehen und auf eine Matratze am Boden legen solle, habe er ihr gesagt: "Er würde mich dann an verschiedenen Stellen (Bsp. Busen) massieren und streicheln, um zu sehen, wie ich darauf reagieren würde."
Frau N. hatte mit Blaser nicht nur als Patientin, sondern etliche Jahre später auch als Arbeitskollegin zu tun. Um die Begegnungen mit ihm am Arbeitsplatz zu erleichtern, war die inzwischen ausgebildete Therapeutin bereit, sich mit Blaser zu einem Gespräch zu treffen. Dazu schreibt sie: "Wir trafen uns in der Cafeteria. Ich fühlte mich unsicher. Plötzlich nahm Herr Blaser meine Hand, sagte mir, ich solle doch 'Andy' zu ihm sagen und erklärte, dass es ihm damals sehr leid getan habe, dass er mir nicht helfen konnte, denn er habe mich sehr gerne gehabt - wie es denn jetzt im Bett gehe. Die Situation war mir äusserst peinlich." Später sei es zu weiteren für sie peinlichen Begegnungen gekommen. So habe Blaser sie in der Bibliothek des Hauses zur Begrüssung zu umarmen versucht.
Nichtssagender Standardbrief
Anders als Anton Weber, Generalsekretär der Gesundheits- und Fürsorgedirektion, der die Untersuchung in Sachen Blaser führte, sah Fisch es als seine Pflicht an, Frau N. zu einem persönlichen Gespräch zu bitten, um sich ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen eingehender schildern zu lassen. Nachdem er mit ihr gesprochen hatte, war er nach eigenen Angaben "schockiert". Weber hingegen verzichtete trotz Frau N.s ausdrücklichem Angebot, persönlich bei der Behörde zu erscheinen, auf eine klärende Unterredung. Stattdessen lud er Blaser und den Frauenspital-Direktor Schneider vor. Von Professor Fisch erbat er sich indessen nur schriftliche Auskünfte.
Als Frau N. in der Lokalpresse von der Einstellung der Untersuchung gegen Blaser erfuhr und sich mit der Bitte um eine Erklärung an die Behörden wandte, wurde sie mit einem unwirschen und gleichzeitig nichtssagenden Standardbrief abgewimmelt: "Wie Sie der Tagespresse entnehmen konnten, wird an der unserer Direktion unterstellten UFK/KFS (das Frauenspital, die Red.) durch Herrn Prof. A. Blaser keine Vaginismustherapie mehr durchgeführt." Frau N. blieb frustriert und ernüchtert zurück.
Ähnlich erging es Professor Fisch, dessen Wunsch nach Klärung der Affäre um Blaser ebenfalls unbefriedigt geblieben war. Fisch wurde klar, dass er der Sache selber auf den Grund gehen musste.
Dabei war ihm durchaus bewusst, dass er sich in gewissen Fachkreisen und im Berner Filz unbeliebt machen würde. Immerhin hatte sein Kollege Wolfgang Böker, Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Bern, öffentlich betont, wie sehr er Blaser "wegen seiner grossen Erfahrung und Korrektheit" schätze. Der international bekannte Psychologie-Professor Klaus Grawe hatte Blaser als "absolut seriösen Forscher und Therapeuten" gepriesen. Nicht zu vergessen Henning Schneider, der betont, wie positiv das Feedback jener Gynäkologen sei, die regelmässig Patientinnen in Blasers Sexualtherapie überwiesen. Hätte Marcel Walther noch gelebt, jener Berner Gynäkologe, der im letzten Frühjahr zuerst seine Schwägerin und dann sich selber umgebracht hatte, hätte auch er mit Sicherheit einige lobende Worte zugunsten des "Professors" gefunden, wie er ihn gerne nannte. Denn Walther hatte während rund zehn Jahren eng mit Blaser kooperiert und ihn zum Zeichen seiner Verbundenheit gar mit einem Schlüssel zu seiner Praxis ausgestattet. Dort wirkte Blaser einmal die Woche sexualtherapeutisch.
Massive Übergriffe
Schliesslich kam Fisch auch mit Frau B.* in Kontakt. In einem vierstündigen Gespräch schilderte sie ihm ihre mehrjährige Erfahrung als Psychotherapie-Patientin in Blasers Privatpraxis. Nach mehreren Unterleibsoperationen hatte sie unter schweren Depressionen gelitten. Ihr damaliger Gynäkologe Walther hatte ihr Professor Blaser "als grosse Kapazität, ja, regelrechten Guru" wärmstens empfohlen.
Die mangelnde Bereitschaft, sich vor ihm ganz auszuziehen, habe Blaser gegenüber Frau B. stets zur Vertrauensfrage emporstilisiert. Da sie sich standhaft weigerte, BH und Slip auszuziehen, habe er bei Stundenbeginn regelmässig gestichelt: "Und - was machen unsere Hemmungen?" Er habe ihr den Nutzen des Nacktseins gern am Beispiel seiner eigenen Therapie zu belegen versucht, die er "zu 60 Prozent nackt absolviert" habe.
"Blaser", schilderte Frau B. gegenüber Fisch, habe sich "regelmässig halb sitzend, halb liegend auf grossen Kissen auf den Boden gehockt. Er hat mich immer wieder in die Arme genommen. Ich war dermassen verzweifelt und deprimiert, dass ich jede Form von Trost entgegengenommen habe." Da habe sie dann Stunde für Stunde, in Tränen aufgelöst, auf ihrem Therapeuten gelegen, oft nur mit Unterwäsche bekleidet. Sie habe verwirrt gespürt, wie er ihr seinen erigierten Penis gegen den Bauch oder den Rücken drückte. Als es einmal zu einem Samenerguss gekommen sei, habe er gesagt: "Nun hast du eine neue Seite unserer Beziehung kennengelernt."
Sie habe auf diese Situationen mit Scham und Irritation reagiert. Da Blaser schon längst einen Keil zwischen sie und ihren Mann getrieben und sie zu einer für sie völlig unmotivierten Trennung gedrängt habe, habe sie sich isoliert und erst recht auf ihren Therapeuten angewiesen gefühlt.
Schockierendes Material
Schliesslich habe ihr der Herr Professor doch in der ersten Therapiesitzung ausdrücklich und ganz in ihrem Sinn gesagt, dass Gewalt und Sex keinen Platz im Rahmen ihrer Therapie hätten. Also habe sie die Erlebnisse verdrängt. In einem Brief, dessen Entwurf ebenfalls in ihrem Hunderte von Seiten umfassenden Therapie-Tagebuch enthalten ist, habe sie Blaser unmissverständlich klargemacht, dass sie keine sexuelle Beziehung mit ihm wolle. Erfolglos. Blaser habe sie nach wie vor auf den Mund geküsst, ihr ungeniert erzählt, dass er gern mit ihr schmusen würde, ihr Postkarten aus seinen Ferien geschickt oder eine kurze Notiz mit der anzüglichen Frage: "Liebe U.! Wie geht es Dir? (rein therapeutisch gefragt, natürlich) Herzlich Andy."
Nachdem Fisch dieses Material gesehen und Frau B.s Schilderungen gehört hatte, war er tief betroffen. Er nahm zusätzlich Kontakt mit dem Hausarzt der Frau auf und tauschte mit dem psychotherapeutisch geschulten Kollegen seine Erfahrungen aus. Dabei erfuhr er, dass der Arzt eine weitere Ex-Patientin Blasers in Behandlung hatte, die ihm ebenfalls von Grenzverletzungen berichtet habe.
Zusätzlich kam Fisch die Schilderung einer Frau zu Ohren, die Blasers Hilfe wegen einer Beziehungskrise gesucht hatte. Sie erinnerte sich mit Widerwillen an Bemerkungen wie: "Du hast so schöne Augen" oder "Was für eine tolle Figur du hast!" Auch sie fühlte sich gegen ihren Willen und voller Scham dazu gedrängt, sich nackt vor Blaser auszuziehen. Sie wurde den Eindruck nicht los, dass Blaser mit seiner Massage und dem Insistieren auf ihrem Nacktsein "sexuelle Absichten" verfolgt habe.
Von der Journalistin schriftlich mit den diversen Vorwürfen der sexuellen und therapeutischen Grenzverletzungen konfrontiert, zeigt sich Blaser "sehr betroffen". Er weist "die vorgebrachten Anschuldigungen aufs Entschiedenste zurück". "Niemals" würde er einer Patientin von sich aus "ein solches Kompliment machen". Sollte "eine solche Bemerkung dennoch gefallen sein", sei dies "anerkanntermassen Bestandteil der Therapie". Den Vorwurf, er dränge Patientinnen dazu, sich vor ihm auszuziehen, bestreitet er ebenfalls: "Die Patientin bestimmt jederzeit selbst, in welchem Umfang sie sich ausziehen will oder nicht." Alle weitergehenden Anschuldigungen wie jene von Frau B. seien "schlichtweg erfunden. Die behaupteten Praktiken lehne ich vollumfänglich ab."
Blaser blitzt bei Gericht ab
Um sich zu schützen, versuchte Blaser die Publikation dieser Vorwürfe seiner ehemaligen Patientinnen mit einer superprovisorischen Verfügung zu verhindern. Allerdings wies das Berner Richteramt III Blasers Ansinnen glattweg ab. In seiner schriftlichen Begründung hielt der Richter fest, dass "ein öffentliches Interesse an der Publikation von Vorwürfen sexueller Übergriffe in der Therapie glaubhaft gemacht ist."
In mehren Gesprächen machte Fisch nun seinem Untergebenen Blaser klar, dass an eine gemeinsame berufliche Zukunft "auf Grund des gestörten Vertrauensverhältnisses" nicht mehr zu denken sei. Nun ging alles auf einmal ganz schnell. Noch im April kündigte Blaser seine Stelle als Leiter der klinischen Psychologen an der Psychiatrischen Universitätspoliklinik. Für die Zeit bis zu seinem Ausscheiden wurde er mit Forschungsarbeiten betraut. Lehre und Ausbildung sind für ihn tabu, Patienten- und Patientinnenkontakte sind ihm untersagt.
Die neusten Entwicklungen im Fall Blaser haben auch den Ombudsmann Landolf verstummen lassen. Dafür ficht seine Gattin, Heidi Reuteler, umso engagierter. Als Psychologin ist Reuteler ebenfalls Mitglied des Verbandes Bernischer Psychologinnen und Psychologen mit Einsitz im Vorstand. Sie ist eine langjährige Kollegin Blasers und gehört einer Arbeitsgruppe um Blaser an, die Anfang der neunziger Jahre in der "Berner Zeitung" einen heftig umstrittenen Beitrag zum Thema Körpertherapie publizierte. Titel: "Wir arbeiten 'zwangsläufig' täglich an der 'Sexgrenze'". Am 15. Mai liess Reuteler die Leserschaft des "Bund" wissen, "dass Prof. Blaser seit 28 Jahren qualifizierte Lehr-, Forschungs-, Diagnostik- und therapeutische Tätigkeit geleistet hat."
Ebenfalls im Mai dieses Jahres vermeldete die Lokalpresse, dass "gegen Professor Blaser keine Strafverfolgung eröffnet werde, da es an beweismässig erstellten strafrechtlich relevanten Belastungen fehle". Anfang Jahr hatte die "Bürgerkommission für Menschenrechte", eine den Scientologen nahestehende Organisation, ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen vermuteter Verletzung der sexuellen Integrität von Patientinnen durch Blaser ausgelöst. Nach Angaben der zuständigen Untersuchungsrichterin Christine Schaer "wollte oder konnte niemand konkrete Angaben zum Fall machen." Frau B. wollte tatsächlich nicht aussagen, "weil ich das Vertrauen in die Behörden schon lange verloren habe."
Berner Medien ohne Interesse
Die Berner Medien zeigten am Fall Blaser seither kein Interesse mehr. Bislang hat sich kein einziger Journalist an Professor Fisch gewandt, um Auskünfte über die Hintergründe der überraschenden Kündigung Blasers einzuholen. Fisch konstatiert eine "beklemmende Mauer des Schweigens".
Wenigstens wird Henning Schneider, der Direktor des Frauenspitals, nicht darum herumkommen, den Kontakt zu Fisch zu suchen: "Das Frauenspital klärt ab", sagt Schneider", was die eigentlichen Gründe waren, die zur Trennung zwischen Blaser und der Psychiatrischen Universitätspoliklinik geführt haben." In einem zweiten Schritt werde man sich überlegen, ob sich "auch Konsequenzen für die eigene Zusammenarbeit ergeben".
Wo aber bleiben angesichts der jüngsten Entwicklungen die längst fälligen Untersuchungen durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion und durch die Berufsorganisationen? "Wenn die Aussagen der Patientinnen und die umlaufenden Gerüchte nicht endlich ernsthaft untersucht und abgeklärt werden", sagt ein Berner Psychotherapeut, "gerät unser Berufsstand einmal mehr in Verruf." Doch FSP und VBP sehen zur Zeit keinen Handlungsbedarf. Und Anton Weber, Generalsekretär der Berner Gesundheits- und Fürsorgedirektion, hält unbeeindruckt dagegen: "Im Fall Blaser sind bei uns keine weiteren Abklärungen hängig."
* Namen der Redaktion bekannt
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
© Barbara Lukesch